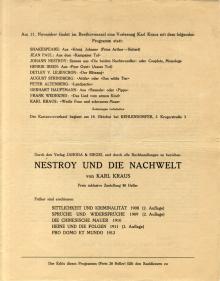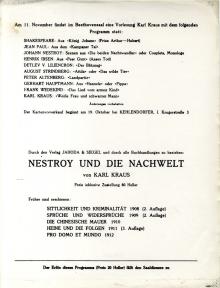[des gedruckten Programms]
I.
Wie verschiedene Köpfe verschieden über die Presse denken
Glossen:
Der Ton
(15 Minuten Pause)
II.
Harakiri und Feuilleton, Gespräch der Kulis
Vorbemerkung
Zu der nun folgenden Lesung der dramatischen Satire »Harakiri und Feuilleton« ist ein Vorwort notwendig. Die handelnden und leidenden Personen sprechen in einem Dialekt. Aber die Darstellung bezweckt nicht den Eindruck, als ob die realen Personen, die in dem dargestellten Milieu leben, denselben Dialekt oder ihn mit derselben Deutlichkeit sprächen. Es mußte dem Darsteller dieses engeren Milieus, da es zugleich das weiteste Milieu der modernen Welt ist, darum zu tun sein, die Personen den Dialekt sprechen zu lassen, den ihre Seele spricht. Ich gestehe, daß ich Figuren, deren Rasse oder Erziehung weit von der Möglichkeit eines solchen Dialektes liegt, auch nicht anders hätte sprechen lassen können. Denn auch ihre Seele spricht diesen Dialekt. Es ist der Weltdialekt, er ist unübersetzbar und doch das einzige Verständigungsmittel zwischen den Sprachen, das wahre Volapük aller, die in der Zeit leben und in der Welt fortkommen wollen. Alle honetten Leute, die sich nach der Decke strecken, sprechen diesen Dialekt. Denn auf seinen Lockruf kommt das Geld herbei. Und so ist er auch die Wünschelrute in der Hand des satirischen Suchers, die ihm alle verborgenen Schlechtigkeiten der irdischen Seele entdecken hilft. Nun hat leider gerade dieser Dialekt, von seinen leisesten Anklängen bis in seine letzten Besonderheiten, die Gefahr, eine komische Wirkung sich selbst zu verdanken. Die Satire erstrebt diese Wirkung nicht, und sie wird durch sie am meisten gerade in den Augen jener herabgesetzt, die sich der Wirkung freuen. Es ist nicht schwer, durch den Ausruf: »Las’r verdienen!« Heiterkeit zu erregen. Aber diese Heiterkeit darf nicht tröstend von dem furchtbaren Gesichtsausdruck ablenken, den die ganze Welt annehmen kann, wenn ich einen gleichgiltigen Einzelnen »Las’r verdienen« sagen lasse. Wenn ich hier ein nachgemachtes schlechtes Geräusch dem Gelächter preisgebe, so vergesse das Gelächter nie, daß nicht weit die Tragödie der Ideale ist, die hinter dem Geräusch verstummen müssen, weil sie des Dialekts entbehren, der allein das Losungswort hat. Aber das Geräusch selbst mache auch seine Sprecher mitleidwürdig. Denn es sind Existenzen, die nur noch im Gehäuse des Ideals leben, welches die Phrase ist und darin ihnen nichts übrig bleibt, als sich satt zu essen, um dann einander aufzufressen. Zwei Generationen von Journalismus stelle ich einander gegenüber, die sich zu einander verhalten, wie der Leitartikel zum Feuilleton. Sie sind einig in der Verachtung dessen, was über das Notwendige und über das Faßbare hinausgeht. Nichts Menschliches ist ihnen fremd, aber alles Göttliche. Mit Helden und Heiligen haben sie keine Verbindung: sprachlos vor dem Geist, ratlos vor der Tat, wissen sie dennoch Bescheid. Die jüngere Generation versucht Rettung und Halt, indem sie Gott, Kunst, Mensch und Natur erklärend betastet. Die ältere lebt ohne Probleme; nichts sei hier zu erklären, denn: »Alles ist bewußt«. Sie täuscht sich durch Sicherheit, die andere durch Frechheit über die geistige Not der Zeit hinweg. Beide leben gottlos: jene braucht ihn nicht; diese mag ihn nicht. Und leben dennoch in ewiger Furcht. In einer anderen Furcht vor einem anderen Herrn, der als der Träger der ausbeutenden Gewalt ihnen den Fuß auf den Nacken setzt und dessen Stimme schon ein so leibhaftiger Akteur ist wie sie selbst. Und in der Furcht vor der Satire, dem einzig Unbegreiflichen, das sie empfinden und zugeben, einer Macht, welche sie wie jene hassen, der sie dienen; einer, deren Stimme ihnen noch unhörbar in die Handlung hineinzusprechen scheint. Die Handlung aber krümmt sich zwischen den Stichworten unsichtbarer Gewalten, von den trostlosen Assoziationen einer engen Welt getrieben, vorwärts bis zur Verzweiflung. Das scheinbar realistische und von lokalen Anlässen bezogene Detail ist nur um jener Naturwahrheit willen verwendet, die ein Symbol ist, und wird darum besser gewertet werden, wo Ort und Zeit die Anlässe entrückt haben. Den Anteil, den die Intimität des Dialekts wie der Stofflichkeit an der satirischen Wirkung hat, verschmäht die Satire. Und das tut sie selbst in der Verwendung von Namen. Diese stützen keine polemische Absicht, sondern sind nur dort den namenlosen Gestalten zugefügt, wo sie ein satirisches Element sind. Alles fügt sich jener nachschöpferischen Ordnung, welche ein individuelles Merkmal als typisch und einen vorhandenen Namen nicht mehr als Zufall, sondern als Notwendigkeit begreifen läßt.
(3 Minuten Pause)
Glossen
Weiße Frau und schwarzer Mann
Der Vorlesung des Schlußstückes kann keine Zugabe folgen.
Änderung vorbehalten
[der Abschrift]
[...]
I.
Wie verschiedene Köpfe verschieden über die Presse denken
Glossen: Stadtverordnete besuchen Gemeinderäte, Geständnisse; Ein Stern ist aufgegangen; Amilisa; Man muss die Leute ausreden lassen; Auf der Such nach Fremden; Ich pfeife auf den Text; petite chronique scandaleuse; Der Ton
II.
Vorwort; Harakiri und Feuilleton
Glossen: Bitte, das ist mein Recht u.s.w.; Grosses Aufsehen; Szene zwischen einem Psychologen und einem Tramway-Kondukteur; Als ich wiederkam; Bin schon wieder da, Herr Gerstl!; Beim Anblick einer sonderbaren Parte.
Weisse Frau und Schwarzer Mann